Vom unvermeidlich Normativen und den Grenzziehungen war in den beiden vorangegangenen Beiträgen die Rede als es um die Frage ging, was Theorie im Hinblick auf künstlerische Fotografie leisten kann und soll. Normen setzen ohnehin die Künstler (mit ihren Bildern und deren jeweiliger Erscheinungsform), der Markt und auch die nach wie vor kanonisierenden Institutionen.
Die Frage nach einer Unterscheidung zwischen „Kunst mit Fotografie“ und „künstlerischer Fotografie“, die besonders in den siebziger Jahren zum einschlägigen Jargon zählte, hat sich heute erübrigt. Fotografie kann Kunst sein, ist es aber – diesem Kurzschluss sollte man nicht aufsitzen – nicht automatisch und muss es auch gar nicht sein. Der schnell ausgesprochene und mittlerweile als Zeichen von “Offenheit” geltende Hinweis darauf, dass es heutzutage ohnehin keine Grenzen mehr gebe, ist nur das Eingeständnis einer inkonsequenten Denkfaulheit; er sollte gerade von Institutionen nicht postuliert werden, die als „Kunstmuseen“ firmieren, sich selbst eine Bildungs-Aufgabe zuschreiben und sich eben dadurch von Kommerz und Unterhaltungsindustrie abgrenzen möchten. Wer alles ausstellt hat seine kritische Funktion verloren! – Bleiben wir also bleiben den klassischen Definitionen der Institutionen und bemerken dennoch eine Besonderheit der Institutionen im Hinblick auf die Fotografie. Denn es gibt seit einigen Jahren Kunstmuseen und Fotomuseen, solche also, die das Medium in den Mittelpunkt stellen. Und diese unterschiedlichen Museen haben, das wird gern vergessen, jeweils unterschiedliche Aufgaben und „Zielgruppen“. (Vgl. zur aktuellen Diskussion in Österreich den Beitrag von Damian Zimmermann: www.damianzimmermann.de/blog/wp-content/uploads/Fotomuseen.pdf)
Im ersten Beitrag zur Frage des Gegenstandes von Foto-Theorie hatten wir zudem eine Nähe derselben zur Kunst-Kritik und zur Kunst-Geschichte festgestellt. Die Theorie sollte in diesem Sinne etwa auch darüber nachdenken, wie man diese beiden verwandten Felder historiografisch darstellen kann und ob (und wenn ja wie) die Fotografie als ein separater oder integrierter Teil der Kunstgeschichte zu verstehen ist. Dabei stellt sich die drängende Frage: um welche Art von Geschichtsschreibung kann es gehen? Daran arbeiten wir uns nicht nur im Sprengel Museum Hannover ab. (vgl. https://www.kleinefotogeschichten.de/)
Eins aber dürfte sicher sein: Die viel zitierte Rede vom „Ende“ sollte man beenden bzw. als eine modische Redewendung historisch einbalsamieren. Denjenigen, den das ohnehin alles zu viel und zu langweilig erscheint (puuuh: „Metatheorie!“), sei an dieser Stelle kurz entgegengekommen, indem wir zu einer (ironischen?) Selbsteinschätzung der Theorie kommen. Denn seien wir ehrlich: Würde es nicht perfekt in unsere nach Empörungshysterie geifernde Zeit passen in einem Essay das „Ende der Foto-Theorie“ zu proklamieren? – Sicherlich nicht, muss man nüchtern antworten, denn dazu ist der öffentliche Stellenwert dieses Unternehmens allzu lapidar. Außerdem könnte es sich bei einem solchen Aufruf nur um einen überaus schlichten Denkfehler handeln, weil die Existenz der Fotografie zwar nicht ihre tiefgründige Reflexion, wohl aber ein wie auch immer banales theoretisches Verhalten bedingt. Foto-Theorie scheint demzufolge zwangsläufig mit einer qualitativen Erwartungshaltung, einem Anspruchs-Denken einherzugehen.
Barthes, Flusser, Derrida, Bourdieu, Sontag (übrigens die einzige Frau) sind tot. Wir scheinen uns aktuell in einem Zeitalter der Historiker der Foto-Theorie zu befinden (für den deutschsprachigen Diskurs: Siegel, von Amelunxen, Stiegler, Geimer). Also, mit Verlaub: was kommt jetzt? Was bleibt zu tun? – Vieles, möchte ich sagen, denn die Gesellschaft und auch die Fotografie hat einen massiven Wandel erfahren. Was dies für die Theoriebildung bedeutet, dürfte klar sein: Denn die in den siebziger und achtziger Jahre von einer damals nur kleinen, aber einflussreichen Gruppe der Theoretiker kontinuierlich wiedergekäuten Überbegriffe des „Index“, der „Spur“, des „Dokuments“ haben im Zeitalter der Digitalisierung ihre Relevanz längst eingebüßt. Das heißt nicht, dass man sie nicht mehr verwenden darf, aber dass sie seit einer bestimmten Zeit (spätestens seit den ausgehenden 80er Jahren) ihre Verbindlichkeit beim Verständnis der künstlerischen Fotografie verloren haben. Selbst wenn es ebenso naiv wäre, eine Referenz zur außerbildlichen Wirklichkeit in jedem Fall zu leugnen, geht es seitdem in stärkerem Maße darum, was das Foto als autonomes Bild leistet. Sowohl die „Wahrheit“ als auch die „Wirklichkeit“ des Fotos beschränkt sich nun keineswegs mehr auf seine Abbild-Funktion. Das muss man in Einzelanalysen einmal konkret weiterdenken. Auf geht’s!
Stefan Gronert
…ist Kurator für Fotografie am Sprengel Museum Hannover
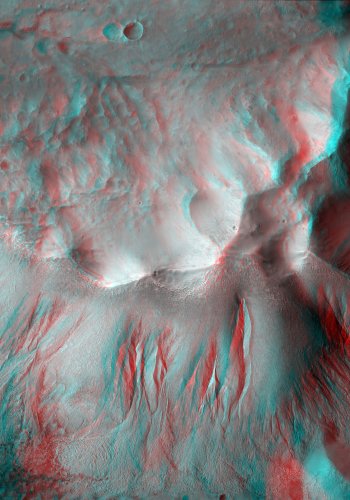
“… Sowohl die „Wahrheit“ als auch die „Wirklichkeit“ des Fotos beschränkt sich nun keineswegs mehr auf seine
Abbild-Funktion. …” ist meiner Meinung nach wirklich ein Gedanke wert.
Ist doch im Analogen die “Wirklichkeit” durch das Negativ gegeben und der Abzug eben “nur” ein Abzug dessen. Die “Wahrheit” selbst lag in der Unveränderlichkeit des Abgebildeten im Filmmaterial.
Das digitale Foto bringt uns eine andere Situation. “Wirklichkeit” erzeugt sich erst durch ein externes Medium wie z.B. durch den Ausdruck der digitalen Daten, die selber ja nur aus Einsen und Nullen bestehen. Und die “Wahrheit” ist relativ, besonders dann wenn die Rohdaten selbst systembedingt ständig wieder verändert werden können und jedes mal neue “Wahrheiten” erzeugen.
Wenn für Museen und Sammler analoge Negative einen besonderen Wert darstellen, wie soll dann mit digitalen Daten umgeggangen werden? Und ich meine nicht die Daten einer Fotografie, die das Museum zu dokumentativen Zwecken angefertigt hat, sondern die originalen Daten des Künstlers. Sind diese ja nicht physisch einzigartig, sondern beliebig duplizier- und veränderbar. Für Archivare sicher spannend.
Für mich persönlich ist jedoch hauptsächlich nur interessant, was das Foto als autonomes Bild leisten kann. Hier liegt sein eigentliches Wesen und Funktion. Lediglich der Umgang damit war ein anderer.
Fotografie diente vornehmlich der Aneignung des Abgebildeten. Es wurde der Urlaub, die Familie, besondere Ereignisse usw. fotografiert und somit dem eigenen Leben zugeschrieben und dieser Vorgang findet heute in der Selfie-Kultur seine Fortführung. Der Mangel an technischer Qualität in der Vergangenheit wurde zumeist anstandslos akzeptiert. Genauso wie heute der Umstand das so gut wie jedes Selfie “bearbeitet” ist und selten dazu dient “Wahrheit” zu dokumentieren. Es werden “Wirklichkeiten” geschaffen, die ebenfalls wieder angeeignet werden können.
Insofern könnte man meinen, das dies schon “autonome” Bilder sind, da ihre Leistung im sozial/gesellschaftlichen Kontext darin besteht künstliche, doppelte Identitäten zu schaffen. Dem ist aber nicht ganz so, denn je künstlicher/artifizieller sie sind desto mehr widersetzten sie sich der Aneignung durch den Autor und das konterkariert die Intention.
Auch ich bin der Meinung, für die Fotografie im Kunstkontext stellt sich die Herausforderung, Bilder zu schaffen, welche sich nicht ohne weiteres aneignen lassen. Sondern sich durch “innere Stärke” diesem Zugriff widersetzen, also tatsächlich autonom sind – auch durch den Autor/Künstler nicht.