Vielleicht wird man überrascht sein, wenn man den Namen einer aufstrebenden jungen Kuratorin im Kontext einer fototheoretischen Diskussion erblickt. Das aber würde bedeuten, die wissenschaftlich anspruchsvollen Beiträge der Leiterin der Fotografischen Sammlung des Münchener Stadtmuseums Kathrin Schönegg zu ignorieren.
Deuteten schon zuvor manche Aufsätze der 1982 geborenen Kollegin ihr Potential an, so markierte spätestens die Publikation ihrer Konstanzer Dissertation „Fotografiegeschichte der Abstraktion“ einen Paukenschlag, der sich speziell einer im 21. Jahrhundert zunehmend populärer werdenden fotografischen Bild-Typ widmet: der Abstraktion. Die Autorin geht das Thema darin mit einem definitorischen Vorspann an und verfolgt das Phänomen in klassischer Manier am Leitfaden der Chronologie, berücksichtigt dabei unterschiedliche Gebrauchsweisen der Fotografie.
Soviel zur groben Struktur eines Buches, das eine Grundlage für die Beschäftigung mit einer besonderen Ausprägung der Fotografie liefert. Für unseren Zusammenhang von besonderem Interesse mag nun der aus zwei Kapiteln bestehende abschließende fünfte Abschnitt von Schöneggs Publikation sein, da dort die jüngere Fotografie unter dem Gesichtspunkt der Abstraktion in den Blick kommt und die Autorin zugleich eine historisch alternative Lesart der Bild-Geschichte liefert.
Noch einmal aber zurück zur Einführung des Buches: Überzeugend führt die Autorin dort ihre grundlegende Prämisse aus, dass die Geschichte der Abstraktion in der Fotografie ganz anders verläuft als im Kontext der Malerei. Dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist, versteht sich von selbst. Im Gegenteil: Schönegg erläutert, dass das Thema der Abstraktion gerade unter den Bedingungen der Digitalisierung der 2010er Jahre eine neue Aktualität gewonnen hat. Handelt es sich aber deshalb, wie sie ihren letzten Abschnitt überschreibt, um eine Reprise der Abstraktion? Oder ist das Abstrakte als genuines Moment der Fotografie eigentlich nie wirklich verschwunden, sondern lediglich in der Rezeption einfach nur in eine Phase der Mode gelangt?
Ihr erstes Schlusskapitel lässt diese Frage offen. Es ist Wolfgang Tillmans Ansatz gewidmet, den sie in seiner Genese verfolgt. Der Titel „Neuerfindung der abstrakten Fotografie im Kleid der Malerei“ mag zunächst verblüffend (frech) klingen, ist aber nicht zwangsläufig negativ ausgerichtet, selbst wenn ihre Bewertung „antiquarisch (rückwärtsgewandt)“ das historische Ideal eines Fortschritts-Denkens enttäuschen mögen. Verfällt sie diesem aber nicht selbst, wenn sie zu Beginn des abschließenden Kapitels meint: „Mit der Digitalisierung tritt die Fotografie ein altes Erbe an: Einst wurde sie für den Tod der Malerei verantwortlich gemacht, mit dem Wechsel zum Digitalen fällt die Endzeitrhetorik auf sie selbst zurück“?
Das lässt sich zweifellos an der begrifflichen Konjunktur von Endzeit-Metaphern nachvollziehen, die Schönegg auflistet. Zugleich vollzieht die fotografische Praxis in einem so genannten „postdigitalen“ Zeitalter, in dem die Dichotomie von analoger und digitaler Bildlichkeit aufgehoben sind, eigentlich nur eine Wiederholung eines kunsthistorischen Modells, dass die Malerei bereits hundert Jahre zuvor vollzogen hat – so die Lesart Schöneggs. Sie vollzieht das an vier verschiedenen Themenfeldern der Abstraktion nach: der Wiederkehr historischer Verfahren (Paradigma: Peter Miller), einer neuen Indexikalität (von Kilian Breier über Helena Petersen, Alison Rossiter bis F & D Cartier), der Simulation des Fotografischen (Thomas Ruff) und der Untersuchung des Digitalen (Adrian Sauer). So wenig trennscharf die Kategorien auch sein mögen, umso eindrucksvoller ist ihre ebenso konzise wie kenntnisreiche Einführung dieser Positionen, die sich beinahe wie eine Fotogeschichte des 21. Jahrhunderts liest. Ernüchternd aber lesen sich zwei der letzten Sätze des Buches: „Zwar ergibt die heutige Abstraktionsbewegung aus der Sicht der Kunstgeschichte wenig Sinn – aus der Perspektive der Fotografiegeschichte hingegen umso mehr. Erst der digitale Wandel hat zu der beschriebenen Krisensituation geführt und ein Problembewusstsein hervorgebracht, wie es die abstrakte Kunst schon im 20. Jahrhundert entwickelt hatte.“
Ist die so diagnostizierte Verspätung der Fotografie aber nicht vielleicht ein Problem einer dualen Sichtweise, die eine seit den 70er Jahren nachweisbare Realität von Fotografie im Sektor der Kunst nicht konsequent anerkennt? Oder ist diese Lesart der Fotogeschichte dann tatsächlich keine (unfreiwillige?) Parodie eines modernistischen Fortschrittsoptimismus, weil sie sich unausgesprochen doch eher an der Bild-Realität einer digitalen Gesellschaft und eben nicht (wie vorgegeben) an einer Geschichte des künstlerischen Bildes orientiert? – Das Feld für die Deutungshoheit über eine angemessene Lesart der Gegenwart scheint eröffnet.
Kathrin Schönegg, Fotografiegeschichte der Abstraktion, Köln 2019
Stefan Gronert
…ist Kurator für Fotografie am Sprengel Museum Hannover
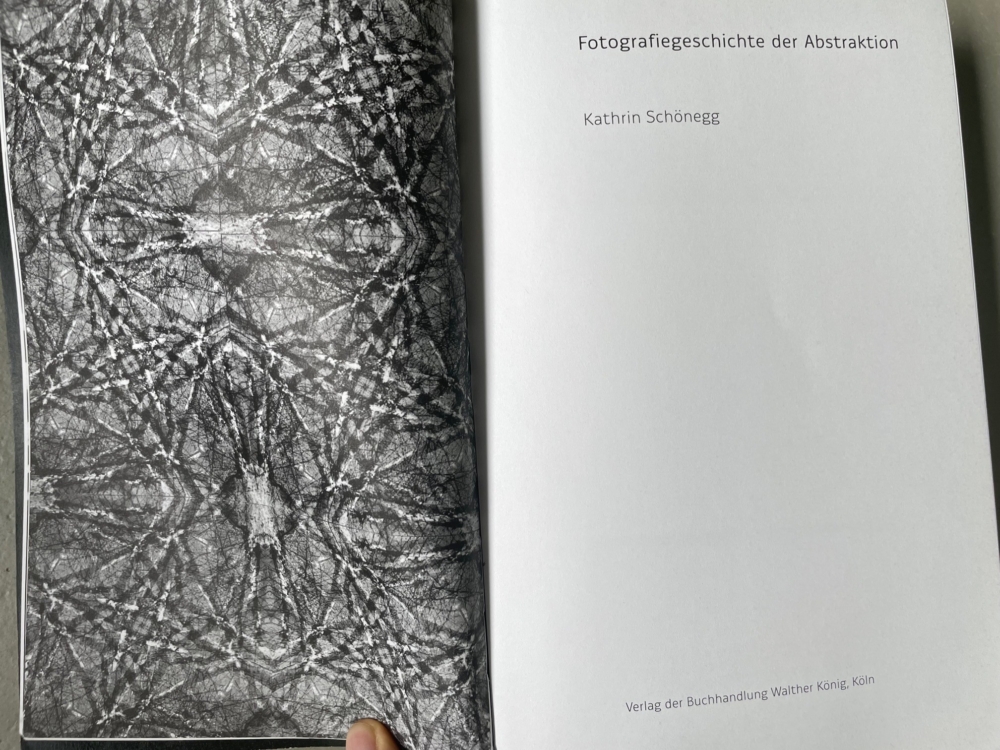
Danke schön wieder einmal für einen Beitrag, der das Nachdenken ueber Fotografie eroeffnet ;-)!!